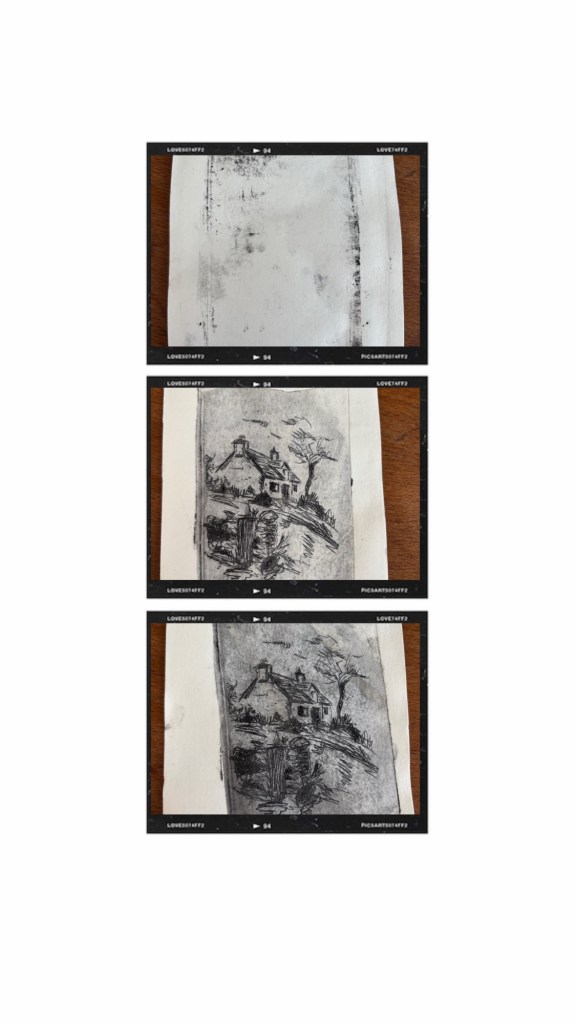(Warum stark sein manchmal nur heißt: duschen und durchhalten.)
Manche stellt sich Resilienz vor wie ein Superheldencape. Oder ein spirituelles Upgrade. Resiliente Menschen – das sind doch diese tiefenentspannten, überlebensfähigen Glückskekse mit Waldblick und Smoothie, die morgens um sechs barfuß meditieren und mit einem inneren Leuchten durch Krisen spazieren.
Andere eher nicht.
Es gibt Menschen, die verwechselten Resilienz zuerst mit „Residenz“. Und merkten dann: Ah, das ist das, was man braucht, wenn man nachts um drei heulend am Küchentisch sitzt und sich fragt, ob das Leben das ernst meint.
Spoiler: Meint es meistens.
Resilienz ist kein Glitzerwort. Es ist das leise „Trotzdem“. Es ist der Moment, in dem man die Zahnpasta nach vier Tagen wieder benutzt. Oder sich traut, einem anderen Menschen zu sagen: „Ich bin müde. Aber ich bin da.“
Und ja – manchmal ist es auch der Entschluss, nicht das achte Achtsamkeitsbuch zu kaufen, sondern einfach mal die Wäsche zu falten. In Ruhe. Und mit dem Gefühl: „Ich funktioniere wieder. Irgendwie.“
Es gibt viele Definitionen für Resilienz: „Widerstandskraft“, „Stehaufmännchen“, „innere Stärke“. In Wahrheit riecht sie oft nach Krankenhaus. Nach Schweigen. Nach Zähigkeit. Und nach einem Kaffee, den man allein trinkt – aber immerhin trinkt.
Wer Resilienz sucht, sollte nicht nach dem perfekten Zustand suchen. Sondern nach dem nächsten kleinen Schritt. Und wenn man ihn gemacht hat, dann: atmen. Kein Instagram. Kein Hashtag. Nur still dasitzen. Noch da sein.
Das reicht. Aber auch das muss man oft lernen.