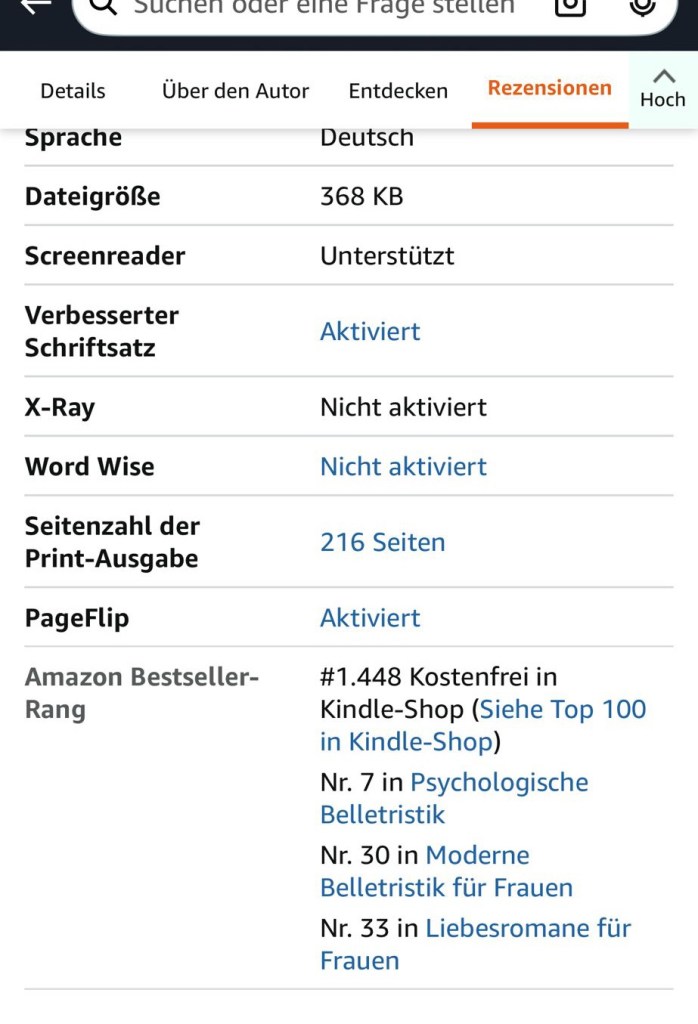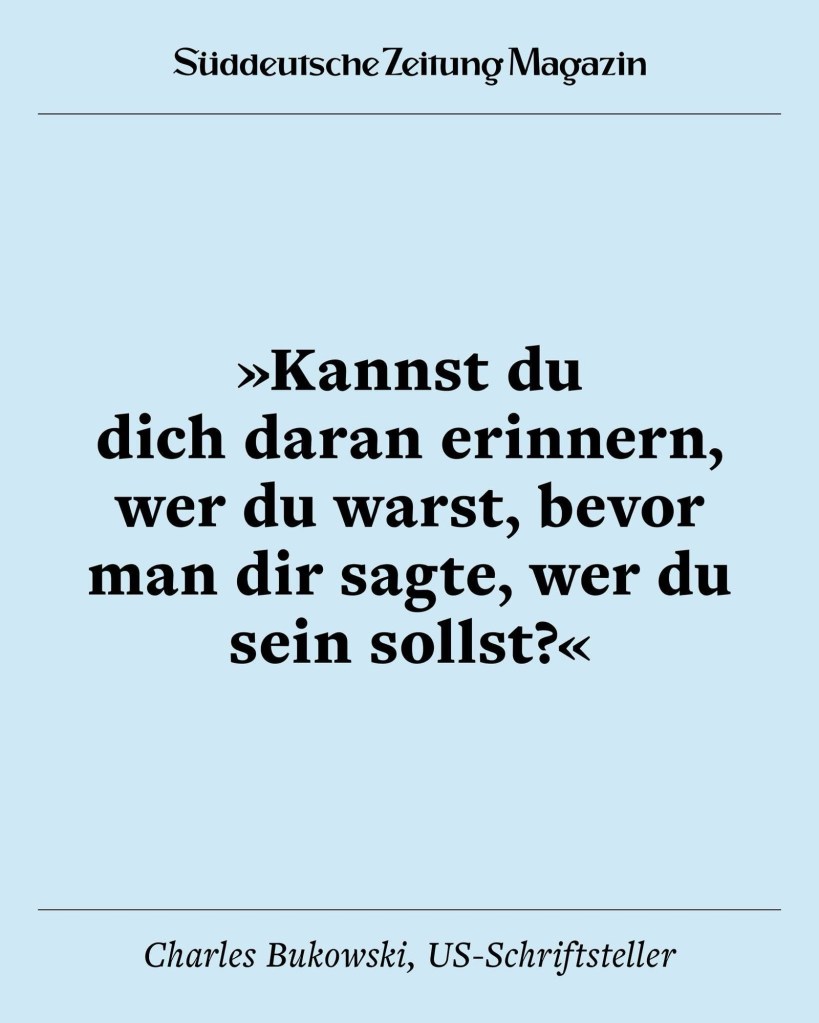Man denkt ja immer, ein Beinbruch sei so etwas wie ein medizinisches Ereignis. Unfall, Gips, Krücken, ein bisschen Netflix, Ende. Ein Kapitel, das man im Kalender abhakt wie „Zahnarzt, 11:30“.
Dann bricht man sich ein Bein – und merkt: Das ist kein Kapitel. Das ist ein Systemupdate. Und zwar eins, das niemand gefragt hat.
Plötzlich ist das Bein nicht einfach ein Bein. Es ist die zentrale Schaltstelle für alles, was im Leben stillschweigend funktioniert hat: Türen auf, Müll raus, Holz rein, Auto wegbringen, kurz zum Bäcker, einmal eben nach dem Rechten sehen. All diese „einmal eben“-Sachen, die im Alltag keine Bühne bekommen, weil sie niemanden interessieren – bis sie wegfallen.
Und dann fällt natürlich nicht nur das Bein aus.
Natürlich ist gleichzeitig ein Trauerfall in der Familie. Natürlich. Denn das Leben hat Humor, aber nicht diese freundliche Sorte, eher so: trocken, schwarz, mit einem Lächeln, das man nicht sehen will. Trauer braucht eigentlich Raum, Zeit, Stille. Sie braucht Hände, die tun dürfen, was sie tun: aufräumen, tragen, sich kümmern, sich ablenken, wieder zusammenbrechen, wieder weitermachen.
Nur: Man sitzt da. Und man merkt, wie absurd es ist, wenn der Körper gerade keine Mitarbeit anbietet. Als hätte jemand den Stecker gezogen und man müsste nun gefälligst „emotional arbeiten“, ohne die gewohnte Flucht in Bewegung. Trauer ohne Gang zum Friedhof, ohne Besuch, ohne „ich fahr schnell hin“. Trauer mit Krücken ist eine besonders gemeine Variante, weil sie einem jede Würde wegnimmt, die man sich sonst heimlich über Aktivität zusammenbaut.
Und während man noch versucht, überhaupt zu verstehen, dass ein Mensch weg ist, fällt einem ein: Das Auto ist auch im Eimer.
Natürlich.
Das Auto ist ja nicht nur Auto. Das Auto ist Freiheit, Versorgung, Logistik, Notfallplan. Das Auto ist der Unterschied zwischen „Ich kümmere mich“ und „Ich schreibe Nachrichten und hoffe, dass jemand antwortet“. Und wenn das Auto kaputt ist, fühlt sich der Beinbruch plötzlich an wie ein schlecht geschriebenes Escape-Room-Spiel: Man braucht Schlüssel A, um Tür B zu öffnen – aber Schlüssel A liegt hinter Treppe C, und Treppe C ist seit dem Beinbruch offiziell nicht mehr in Ihrem Tarif enthalten.
Und dann, als wäre es nicht schon ausreichend symbolisch, ist kein Holz mehr vor der Tür.
Kein Holz.
Oder fast schon ergänzend zu einer echten Symbolik für : Ein funktionierendes Auto mit Anhängerkupplung um das Holz abzuholen, denn mein Händler liefert nicht!
Dieser Satz – kein Holz- klingt harmlos, bis man ihn wirklich lebt. Kein Holz heißt: Kälte wird nicht nur Temperatur, sondern Stimmung. Kein Holz heißt: Man spürt plötzlich die Physik des Lebens. Man spürt, dass Wärme Arbeit ist. Dass Dinge nicht von alleine auftauchen, auch nicht in einem Haus, das man seit Jahren bewohnt. Dass ein paar Meter vom Holzstapel zur Tür eine Distanz sind, die man früher nicht mal gedacht hat – und die jetzt eine Grenze ist, wie eine Zollstation mitten im Flur: „Weiter nur mit funktionierendem Bein.“
Man sitzt also da und denkt: Gut. Dann eben Plan B.
Und hier kommt das Problem: Plan B ist in Wahrheit „Menschen“.
Plan B heißt fragen. Plan B heißt anrufen. Plan B heißt zugeben, dass man gerade nicht kann. Und das ist für viele schlimmer als Schmerzen. Nicht, weil man keine Menschen hat – sondern weil man sich selbst so lange beigebracht hat, dass man nicht zur Last fällt. Dass man sich „organisiert“. Dass man durchhält. Dass man irgendwie alles im Griff hat, solange man laufen kann.
Das Bein ist in dieser Geschichte nicht der Nebendarsteller. Es ist der Lautsprecher, der im ganzen Haus brüllt: Du bist nicht unabhängig. Du warst es nur in ruhigen Zeiten.
Und ja, man kann das dramatisch finden. Man kann aber auch kurz lachen, weil es so unverschämt stimmt.
Ich meine: Da liegt man, geschniegelt im Bett, mit Schmerzmitteln, mit einem Bein, das sich anfühlt wie ein Betonblock, und das Leben stellt sich daneben wie ein schlecht gelaunter Paketbote: „So. Hier einmal Trauer, einmal Auto kaputt, einmal Holz leer. Unterschrift bitte. Ach so, Sie können nicht aufstehen? Tja.“
Was tut man also?
Man macht – leider – das Einzige, was wirklich hilft. Man wird klein.
Nicht jämmerlich. Nicht rührselig. Sondern pragmatisch klein. Man reduziert. Man sortiert. Man lässt Dinge liegen, die liegen dürfen. Man streicht alles, was nur dem eigenen Anspruch dient, nicht dem Überleben.
Man fragt nach Hilfe, bevor man innerlich in die Wand fährt. Man verteilt Aufgaben, auch wenn es sich anfühlt wie Kontrollverlust. Man akzeptiert, dass Trauer nicht besser wird, nur weil man tapfer ist. Und dass Holz nicht auftaucht, nur weil man es sich „vornimmt“.
Und man wird radikal ehrlich mit dem, was gerade wirklich ist:
Heute ist nicht der Tag, an dem man „alles regelt“. Heute ist der Tag, an dem man den nächsten Schritt schafft, ohne sich selbst zu verlieren. Heute ist der Tag, an dem man nicht beweisen muss, dass man stark ist, sondern dass man noch da ist.
Das klingt jetzt fast vernünftig. Ich weiß. Widerlich.
Also sage ich es lieber so, wie es sich anfühlt:
Man überlebt den Tag nicht durch Heldentum, sondern durch kleine, schmutzige Kompromisse.
Man isst, was da ist. Man wärmt sich, wie es geht. Man nimmt Hilfe an, auch wenn man dabei aussieht wie das Gegenteil von glamourös. Man lässt das Auto im Eimer, bis jemand da ist, der es mit Eimerkompetenz anfassen kann. Man trauert in Pausen. Man trauert in Wellen. Man trauert manchmal auch im falschen Moment, zum Beispiel beim Blick auf die leere Holzecke, weil der Körper offenbar beschlossen hat, alles gleichzeitig zu verarbeiten.
Und irgendwann – nicht heute, nicht morgen, aber irgendwann – merkt man, dass dieses Bein nicht nur verhindert.
Es entlarvt.
Es zeigt einem, wie viel vom Alltag auf unsichtbarer Arbeit basiert. Wie viel davon an einem einzigen Körper hängt. Wie schnell „normal“ verschwindet. Und wie sehr man sich daran gewöhnt hat, alles selbst zu tragen – bis nichts mehr trägt, nicht mal man selbst.
Vielleicht ist das die eigentliche Zumutung: Dass man ausgerechnet in einer Phase, in der man Trost bräuchte, auch noch lernen muss, Hilfe auszuhalten.
Aber gut. Wenn das Leben schon unbedingt mit einem Beinbruch um die Ecke kommen muss, dann wenigstens als ehrlicher Spiegel.
Und falls heute niemand Holz vor die Tür legt, was niemand tun wird.
Dann ist es eben kalt.
Und man bleibt trotzdem hier.