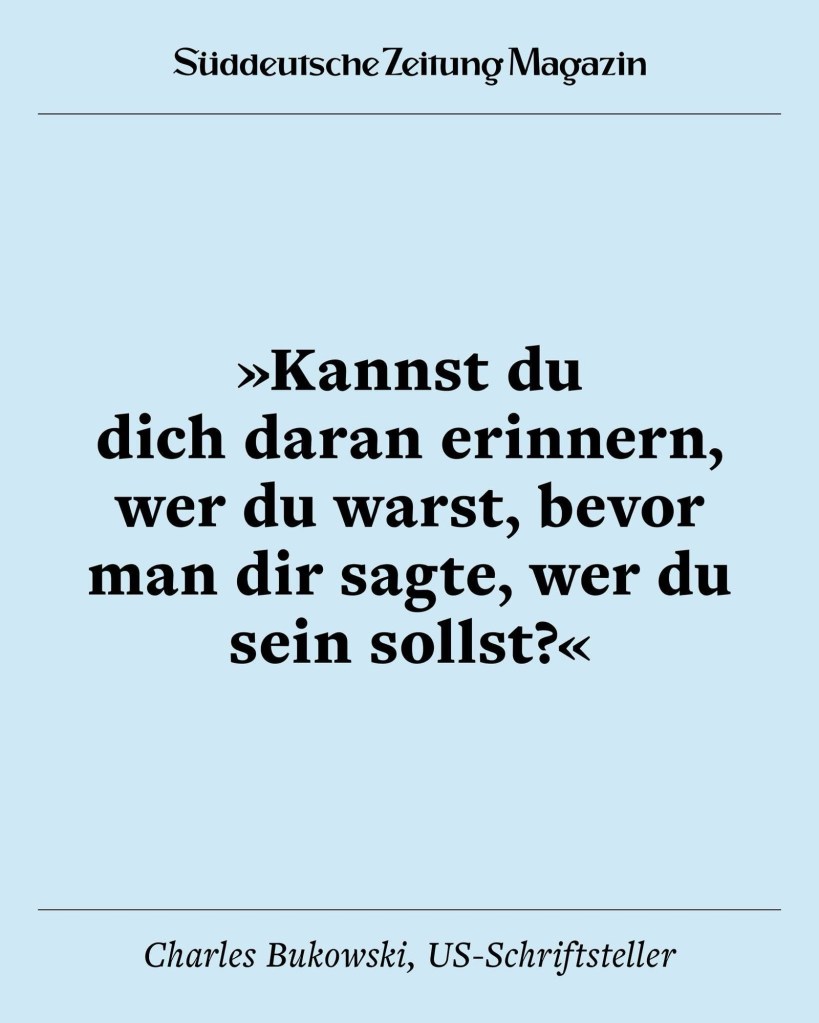Er ist schüchtern. Nicht dieses „ich tu so“-schüchtern, sondern die echte Sorte: leise, konzentriert, unaufgeregt. Einer, der nicht mit Worten um sich wirft, als wären sie Konfetti. Und gerade deshalb bleibt alles, was er doch sagt – oder nicht sagt – irgendwo hängen. Tiefer, als es höflich wäre.
Ich bewundere ihn. Und ich meine nicht dieses oberflächliche Bewundern, das man Menschen schenkt, die gut aussehen, gut riechen und im richtigen Licht stehen. Ich meine das stille, fast altmodische Verehren, bei dem man sich ertappt, wie man plötzlich aufmerksamer wird, sobald der Raum ein kleines bisschen anders klingt. Als hätte jemand die Welt kurz auf „klar“ gestellt.
Es ist diese Zärtlichkeit, die nicht gemacht wirkt. Nicht geschniegelt, nicht einstudiert, nicht „ich habe mal gelesen, Frauen mögen…“. Sondern diese kleine, feine Aufmerksamkeit, die man nicht kaufen kann: ein Blick, der nicht über dich hinweggeht. Eine Stimme, die nicht drängelt. Eine Ruhe, die sich nicht wichtig macht. Und plötzlich denkt man: Ach. So fühlt sich Respekt an, wenn er nicht nach Business aussieht.
Ich habe es ihm nie gesagt. Natürlich nicht. Weil ich ja nicht komplett den Verstand verloren habe. (Nur so ein bisschen, an den Stellen, wo man wieder menschlich wird.) Man sagt nicht einfach: „Du berührst mich im Innersten.“ Man sagt: „Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.“ Man nickt, man hält sich an Regeln, man spielt Erwachsensein.
Aber innerlich läuft ein zweites Gespräch. Ein zärtliches, ein heimliches.
In dem zweiten Gespräch würde ich sagen:
Dass ich mich sicher fühle, wenn er da ist.
Dass seine Schüchternheit nicht Abstand schafft, sondern Nähe – weil sie ehrlich ist.
Dass seine Hände nicht nur „fähig“ sind, sondern behutsam.
Dass er dieses seltene Talent hat, einen Menschen zu behandeln, ohne ihn zu verkleinern.
Und dann würde ich wieder leiser werden. Nicht aus Feigheit. Eher aus Ehrfurcht. Weil manche Gefühle zu schön sind, um sie sofort in die Welt zu stellen wie ein Schild.
Vielleicht ist es genau das: Man begegnet manchmal Menschen, die einen nicht mit großen Gesten beeindrucken, sondern mit der Art, wie sie in kleinen Momenten bleiben. Wie sie nicht eilen, wenn du innerlich noch nicht nachkommst. Wie sie nicht übertönen, was in dir leise ist.
Und dann passiert etwas Seltsames: Du erwischst dich dabei, wie du dir wünschst, die Zeit würde kurz langsamer laufen. Nur ein bisschen. Dass es noch einen Satz mehr gäbe. Noch einen Blick. Noch diese eine Sekunde, in der die Welt nicht laut ist, sondern sanft.
Denn es ist nicht nur Bewunderung. Es ist dieses warme Ziehen, das nicht nach Drama schmeckt, sondern nach Ruhe. Nach: Da ist jemand, der mit dir umgehen kann, ohne dich zu zerreden. Da ist jemand, bei dem du nicht besser sein musst, um ernst genommen zu werden. Da ist jemand, der dir – ohne ein einziges großes Wort – das Gefühl gibt, dass du genau so, wie du gerade bist, richtig bist.
Ich verehre ihn, ohne es ihm je gesagt zu haben. Und vielleicht ist das sogar gut so. Manche Dinge bleiben schöner, wenn sie nicht gleich in Sprache gepresst werden. Wenn sie erst mal nur im Herzen wohnen dürfen, wie ein Licht in einem Fenster, das man nicht ausschalten will.
Und wenn ich mir am Ende erlaube, einen einzigen romantischen Gedanken zu denken, dann ist es dieser:
Vielleicht sind es nicht die lauten Geschichten, die uns verändern, sondern die leisen. Die, in denen jemand nichts verspricht – und trotzdem etwas in dir heilt, das du gar nicht als Wunde erkannt hattest.
Und vielleicht ist das die zärtlichste Form von Nähe:
Wenn jemand dich ansieht, als wärst du nicht „ein Fall“, nicht „ein Termin“, nicht „die Nächste“, sondern einfach… ein Mensch.
Einer, den man behutsam behandelt.
Einer, bei dem man unwillkürlich weicher wird.
Und jetzt kommt der Teil, der das Ganze endgültig absurd macht:
Er ist mein Chirurg. 🙂